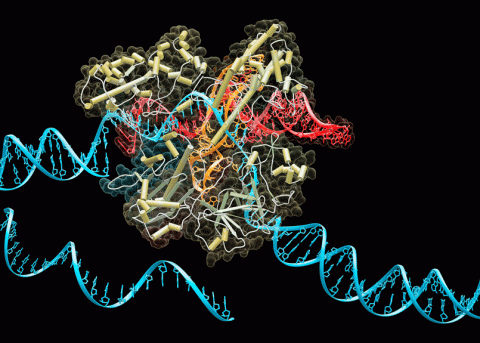Synthetische Biologie: Die Maschine lebt
Während die GentechnikerInnen noch um die gesellschaftliche Akzeptanz ihres Forschungsfelds kämpfen, tritt eine neue Generation von BiologInnen auf den Plan: Pflanzen und Tiere gentechnisch verändern? Dann doch gleich künstliches Leben erschaffen!
Für viele Kritiker nicht nur aus kirchlichen Kreisen ist die Gentechnik so etwas wie die moderne Ursünde: Der Mensch greift schöpfergleich in die Evolution ein, indem er artfremde Gene in Tiere und Pflanzen einbaut. Doch während Politik, Industrie und Öffentlichkeit noch über Chancen und Risiken und ethische Implikationen streiten, bahnt sich in einigen Laboren etwas an, neben dem sich die bisherige Gentechnik wie ein Vorgeplänkel ausnimmt: ForscherInnen wollen neue, künstliche Lebensformen erschaffen, die sich, Maschinen gleich, auf eine bestimmte Aufgabe hin konstruieren lassen.
Die synthetischen Mikroben sollen eines Tages im grossen Stil Medikamente oder Wasserstoff zur Energieversorgung produzieren – und damit einen weiteren biotechnologischen Milliardenmarkt eröffnen.
«Synthetische Biologie» nennt sich das neue Forschungsgebiet unbescheiden. So soll die Biotechnologie den Sprung vom mitunter hemdsärmlig ausgeführten Laborhandwerk zur echten Ingenieursdisziplin schaffen. Die Vertreter der synthetischen Biologie wollen das kaum zu überblickende (und dementsprechend auch erst lückenhaft verstandene) Zusammenspiel aus Genen, Enzymen und anderen Molekülen in einer lebenden Zelle nach dem Vorbild von Elektro- und Computeringenieuren in einfache und programmierbare Bioschaltkreise umwandeln. Als Versuchsmaterial dienen dabei fürs Erste einfache Bakterien wie Escherichia Coli oder die Parasiten der Gattung Mycoplasma, die nur einige Hundert Gene haben (im Vergleich zu gut 20 000 beim Menschen).
Lego in der Zelle
Einer der Ansätze, mit dem die Biologen arbeiten, folgt der Logik der Legosteine: Man stattet Bakterien mit standardisierten Genelementen aus – sogenannten Biobricks – und baut so ganz neue Funktionsweisen auf einem zellulären Grundgefüge auf.
ForscherInnen am Massachusetts Institute for Technology (MIT) haben in einer Datenbank schon mehr als zweitausend solcher Biobricks gesammelt, die alle möglichen Funktionen abdecken. Damit könnten, so die Vision, Zellingenieurinnen dereinst eine biologische Wirkungskette am Reissbrett entwerfen sowie Elektroingenieure ein Schaltbild aus Widerständen, Kondensatoren oder Dioden zeichnen. Anschliessend würden die entsprechenden Genabschnitte ins Zellgenom eingebaut. «Es geht darum, das Design solcher biologischer Systeme einfacher zu machen und die Konstruktion zu automatisieren», erklärt MIT-Forscher Drew Endy, einer der Gründer der Biobrickdatenbank (und Hobbycomicautor).
Verschiedene Forschungsgruppen gehen gar so weit, das Genom eines Bakteriums zunächst auf jenes Minimum zu reduzieren, das gerade noch die notwendigen Lebensfunktionen enthält. Dann möchten sie je nach Bedarf weitere Gene hinzufügen, die etwa die Produktion medizinischer Wirkstoffe auslösen. Diese Minimalbakterien werden inzwischen in Anlehnung an die Automobiltechnik auch als «Chassis» bezeichnet.
Schnörkelloses Leben
Besonders umtriebig ist hierbei wieder einmal das J. Craig Venter Institute aus Rockville im US-Bundesstaat Maryland, benannt nach seinem umstrittenen Gründer, der sich vor einigen Jahren ein Wettrennen mit dem internationalen Human-Genom-Projekt um die Sequenzierung des menschlichen Erbguts geliefert hat. Letztes Jahr stellte das Institut eine Liste von 101 Genen des Bakteriums Mycoplasma genitalium vor, die nach derzeitigem Erkenntnisstand überflüssig sind – biologische Schnörkel sozusagen. Aus den 381 verbleibenden und zusätzlichen Designergenen sollen sodann beliebige, aufs Wesentliche reduzierte Genome synthetisiert werden. Ende Juni hat die Gruppe an der «Synthetic Biology 3.0»-Konferenz in Zürich und in einem «Science»-Paper erste Erfolge auf dem Weg zum künstlichen Bakterium vermeldet.
Solche Minimalbakterien sollen eines Tages dazu eingesetzt werden, Wasserstoff und Ethanol zu produzieren. Damit will Venter einen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung leisten. Dass er nicht zuletzt auch handfeste ökonomische Interessen hat, offenbarte er allerdings kürzlich im US-Magazin «Newsweek»: «Wenn wir einen solchen kraftstoffproduzierenden Organismus machen könnten, wäre das der erste Milliarden-Dollar-Organismus.»
Wo viel Geld im Spiel ist, sind Patente nicht weit. Und so meldete das Venter-Institut Ende Mai schon mal vorsorglich ein US-Patent auf ein solches Minimalbakterium an – Name: Mycoplasma laboratorium. Der Inhalt der Patentschrift hat es in sich. Sie beantragt Schutz nicht nur für sämtliche Gene des Minimalgenoms und jeden Organismus, der auf ihrer Basis hergestellt wird. Auch jede andere Variante des Mycoplasmabakteriums, die auf mindestens 55 der 101 «unwesentlichen» Gene verzichtet, will Venter für sich beanspruchen.
Jim Thomas von der kanadischen ETC Group, die seit Jahren Entwicklungen in Bio- und Nanotechnik kritisch begleitet, befürchtet, dass hiermit der Grundstein zu einem weit reichenden Monopol für die Biotechnik der Zukunft gelegt werden soll: «Die Frage ist: Wird Venters Unternehmen zu einem 'Microbe-soft' der synthetischen Biologie?» Venter versuche, so Thomas, eine Art «Betriebssystem» für künftige Biomaschinen zu patentieren.
Venter selbst hat zwar erklärt, es handle sich nur um ein «Verfahrenspatent». In der Patentschrift würden jedoch auch explizit «frei lebende Organismen, die wachsen und sich replizieren», auf der Basis des zuvor aufgelisteten Minimalgenoms erfasst, korrigiert Thomas. «Es ist einfach nicht wahr, dass das Patent nur technische Verfahren betrifft», sagt er. «Wir glauben, dass Venters Bakterium eine sehr viel grössere Sache sein wird als das Klonschaf Dolly.»
Biologische Bastelbögen
Doch der Wettlauf um neue Patente und Monopole ist nicht der einzige Streitpunkt rund um die synthetische Biologie. Die im Internet frei zugänglichen Gensequenzen der Biobricks könnten, so die Befürchtung, auch dazu missbraucht werden, ganz neue biologische Waffen zu schaffen. Ein «Biohacker» kann das nötige Genmaterial im Prinzip im Internet bestellen und sich per Post in sein Labor liefern lassen.
Gautam Mukunda von der Boston University, der an einer Studie zur Sicherheit in der synthetischen Biologie arbeitet, skizziert ein denkbares Zukunftsszenario: Ein Biohacker nimmt ein vom Immunsystem toleriertes Chassis, dazu ein umprogrammiertes Genom, das schlafauslösende Hormone produziert, und einen Mechanismus, der dem Gebilde erlaubt, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren – und bekommt so ein Mittel, das Menschen in Tiefschlaf versetzt. Gerade solche nichttödlichen biologischen Waffen hält Mukunda für besonders gefährlich: «Sie könnten den seit Jahrzehnten bestehenden Konsens aufweichen, keine B-Waffen einzusetzen.» Immerhin, die Szene nimmt solche Risikoszenarien ernst. Um sich dagegen zu wappnen, seien unter anderem eine White List vertrauenswürdiger Firmen und Institutionen, von denen Gensynthese-Unternehmen Aufträge annehmen können, eine Liste von Genen, die zu bekannten Erregern gehören, und eine standardisierte Prüfsoftware für bestellte DNA-Sequenzen nötig, schlägt etwa Ralf Wagner vom deutschen Lieferanten Geneart vor. Gautam Mukunda fordert darüber hinaus eine internationale Biosicherheitsorganisation und die Bereitschaft der Forschergemeinde, bestimmte Experimente bei einem neu erkannten Risiko auszusetzen.
Unklar ist auch, was passiert, wenn Designerbakterien in die freie Wildbahn gelangen. Könnten sie womöglich zu einem Krankheitserreger mutieren? Der Harvard-Biologe George Church setzt hier zum einen auf von der Umwelt isolierte Hochsicherheitslabore. Zum anderen will er aber auch die Biologen selbst in die Pflicht nehmen. Man müsse Einzeller so entwerfen, dass sie ausserhalb einer Laborkultur zugrunde gehen, weil sie nur dort die entscheidenden Nährstoffe bekommen, die sie zur Erfüllung ihrer Mission benötigten, so Church. Oder man programmiere ihnen eine Art Zeitzünder ein, der irgendwann automatisch den Zelltod herbeiführt.
Steve Benner von der University of Florida glaubt dagegen an die Schutzwirkung der Evolution, die irdischem Leben über Millionen von Jahren gewissermassen einen Standortvorteil verschafft hat: «Die Erfahrung mit genetisch veränderten Organismen hat gezeigt, dass sie im Vergleich zu ihren natürlichen Gegenstücken in natürlichen Umgebungen weniger fit sind.» Aber die Biomaschinenbauer wären keine echten Ingenieure, wenn es ihnen nicht gelänge, diesen kleinen Konstruktionsfehler ihrer Geschöpfe eines Tages auch noch zu beheben.
Die Biobrickdatenbank im Internet: parts.mit.edu