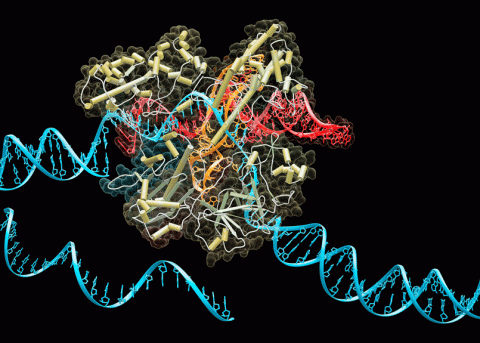Personalisierte Medizin: Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Gene
Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung nimmt in seinem eben veröffentlichten Bericht die Versprechungen der personalisierten Medizin unter die Lupe. Was bringt Big Data im Gesundheitswesen?

Wer mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist, bekommt die Grenzen der Medizin mitunter rasch zu spüren: Drei von vier PatientInnen sprechen in der Therapie nicht auf Medikamente an. Das möchte die personalisierte Medizin ändern, indem sie die individuellen biologischen Merkmale der Menschen in den Fokus rückt. Aufgrund von Erbgut- respektive Genomanalysen und einer Vielzahl weiterer molekularer Daten zum Stoffwechsel und zu den im Körper aktiven Proteinen soll es künftig sogar möglich werden, das Risiko einer Erkrankung frühzeitig vorauszusagen – und diese möglichst zu vermeiden. Ein grosses Versprechen, nicht nur im Fall von Krebs.
Damit bahnt sich ein Paradigmenwechsel in der medizinischen Forschung an: Im Zentrum stehen jetzt biologische Prozesse auf der molekularen Ebene und ihre informationstechnologische Verarbeitung. «Big Data» ist auch in der Medizin angekommen.
Bund will Biobanken
Für wenige Hundert Franken kann heute jede ihr Genom bei kommerziellen Firmen wie 23 and Me analysieren lassen und ihre Gesundheit mit Smarttrackern am Handgelenk überwachen – mit Sensoren, die permanent Indikatoren wie Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung oder Blutzucker messen. Oder sich im Internet auf Social-Media-Plattformen wie Patients Like Me mit andern über seine Krankheit austauschen. Die Flut der so generierten Gesundheitsdaten wird von den kommerziellen Anbietern ausgewertet und weiterverkauft, zum Beispiel an die Pharmaindustrie. Ihr ökonomischer Wert ist riesig: Das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt den jährlichen Wert von Big Data allein für das Gesundheitswesen der USA auf 300 Milliarden US-Dollar. Längst hat sich der Internetgigant Google 23 and Me einverleibt.
Auch die Forschung ist an solchen gesundheitsbezogenen Daten interessiert. Sie sollen der personalisierten Medizin zum Durchbruch verhelfen. Dazu braucht es indes noch weit mehr und vor allem nach einheitlichen Kriterien erhobene und systematisch gesammelte Daten – mit andern Worten: ein elektronisches PatientInnendossier und Biobanken. Im Rahmen der E-Health-Strategie des Bundes soll das elektronische Dossier 2015 eingeführt werden, jedoch auf freiwilliger Basis. Bundesrätliche Vorstösse zur Errichtung von Biodatenbanken hat das Parlament wiederholt abgelehnt.
Promotoren der personalisierten Medizin wie der ETH-Biologe Ernst Hafen geben sich aber nicht geschlagen. Bereits 2011 hat er an einer Tagung der Stiftung Academia Engelberg für flächendeckende Genomtests lobbyiert – unter anderem mit den Testresultaten seiner Familie. 2012 hat er den Verein «Daten und Gesundheit» mitbegründet, vor einem Jahr dann die Genossenschaft Healthbank ins Leben gerufen: Für hundert Franken kann man ein Konto eröffnen, um dort via Apps oder E-Mail seine persönlichen Gesundheitsdaten einzuspeisen und zu verwalten. Gratis ist die Nutzung des Kontos indes nur, wenn man bereit ist, seine Daten für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen.
«Ich erachte es als eine soziale Verpflichtung, die eigene Krankengeschichte anonym an die Allgemeinheit weiterzugeben», so Hafen im Onlinemagazin «UZH-News» der Universität Zürich. Peter Meier-Abt, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, fordert gar einen «Daten- und Informationsspenderausweis» für alle; wer kein Veto einlegt, gilt automatisch als SpenderIn. Auch ÄrztInnen und anderes Gesundheitspersonal will er zum Erheben und Sammeln von elektronischen Gesundheitsdaten verpflichten.
Gläserne PatientInnen
Am 28. März hat das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss einen Bericht zur personalisierten Medizin veröffentlicht. Auch er empfiehlt eine nationale Biobank. Wahrscheinlich vor allem weil ohne sie keine Evidenz für den tatsächlichen Nutzen der personalisierten Medizin zu erbringen sein wird, wie der Mediziner Vincent Mooser im Bericht nahelegt.
Tatsächlich stehen die ExpertInnen, die den Bericht verfasst haben, der personalisierten Medizin überwiegend skeptisch gegenüber. Big Data ist ein Grund. Zum einen weil selbst eine Anonymisierung der Daten nichts nützt: «Um ein Individuum mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, reichen dreissig bis achtzig unabhängige DNA-Merkmale aus», heisst es im Bericht. «Ein absoluter Schutz dieser Daten ist aus technischer Sicht nicht möglich.» Und das kann unabsehbare Folgen für die Betroffenen haben, denn sowohl Lebens- und Krankenversicherungen als auch ArbeitgeberInnen haben ein grosses Interesse an Gesundheitsdaten. «Mit den sehr grossen und aussagekräftigen Datenmengen, die bei der personalisierten Medizin erhoben werden, geht eine Diskriminierungsgefahr für jeden Einzelnen und jede Einzelne einher.»
Damit droht das Recht auf Privatheit und informationelle Selbstbestimmung faktisch ausgehebelt zu werden. Selbst wenn aus rechtlicher Sicht niemand gezwungen werden kann, sich einem genetischen Test zu unterziehen: Wie freiwillig ist ein solcher Test noch, wenn man den Job oder die Versicherung nur bekommt, falls man ihn macht?
Big Data wirft nebst dem Datenschutz ein weiteres Problem auf: Für einen medizinischen Erkenntnisgewinn taugen herkömmliche Verfahren zum Umgang mit Daten nicht. Ein gefürchteter Fallstrick sind vor allem die sogenannten Scheinkorrelationen: Der Computer spuckt einen statistischen Zusammenhang aus, der gar nicht auf ein Ursache-Wirkung-Prinzip zurückgeführt werden kann. Bei der Interpretation von molekularen Daten stösst man rasch an die Grenzen des Wissens, weil es an Informationen fehlt, wie eine Beobachtung einzuordnen ist, hält der Bericht fest.
Anders gefragt: Was taugen die Vorhersagen über ein Erkrankungsrisiko, wie sie Firmen wie 23 and Me aus Gentests erstellen? Solche Fragen führen zum Kern der personalisierten Medizin und zu einem weitverbreiteten Irrtum, der mit ihr verbunden ist: Personalisierte Medizin bedeutet nicht massgeschneiderte Medizin – im Zentrum der Datenanalyse steht nicht das Individuum mit seinen Bedürfnissen. Vielmehr werden Personen aufgrund von charakteristischen Mustern in ihren biologischen Eigenschaften zu Gruppen zusammengefasst. Wenn es um Krankheitsrisiken geht, lassen sich Resultate aus gruppenspezifischen Untersuchungen aber nicht einfach auf beliebige Individuen übertragen.
Ausserdem spielen bei der Entstehung der meisten Krankheiten verschiedene Gene auf komplexe Art und Weise mit Umwelteinflüssen zusammen. Diese werden jedoch in der personalisierten Medizin kaum berücksichtigt. Noch immer ist eine Familienanamnese, eine Krankengeschichte, wie sie jede Hausärztin erhebt, viel aussagekräftiger als Erkenntnisse, die sich aus genetischen Informationen gewinnen lassen. Der im Bericht zitierte Sozialmediziner Heiner Raspe ist sogar der Meinung, die Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit von Krankheiten werde grundsätzlich überschätzt – was sowohl Patientinnen als auch Ärzte unter zunehmenden Druck setze, der aus wissenschaftlicher Perspektive nicht gerechtfertigt sei.
Selber schuld
Die Interpretation von Gentests überfordert viele Ärztinnen, hält der Bericht fest. Wie sollen sie da ihren Patienten vermitteln, was ein vermeintlich individualisiertes Risikoprofil für eine künftige Krankheit bedeutet?
Die Verantwortung für Gesundheit und Krankheit verlagert sich mit den Versprechungen der personalisierten Medizin immer mehr auf die PatientInnen. «Dies könnte den Druck auf die Kranken erhöhen, weil sie nicht mehr nur als hilfsbedürftige Opfer wahrgenommen würden, sondern als Täter, die einem Lebensstil gefrönt haben, der sich schlecht mit ihrer Veranlagung vertrug», so der Bericht. «Verliert ein Mensch künftig Anspruch auf Unterstützung durch die Solidargemeinschaft, wenn er wirksame Vorbeugemassnahmen für seine Gesundheit treffen könnte, es aber nicht tut?»
Mit der personalisierten Medizin verbinden sich zahlreiche Hoffnungen – Hoffnung auf eine Medizin, die dem einzelnen Menschen stärker zugewandt ist, Hoffnung auf die Prävention von Krankheiten und auf ein effizienteres Gesundheitssystem. Vieles davon, so viel macht der TA-Swiss-Bericht klar, wird sich kaum realisieren lassen. «Personalisierte Medizin mobilisiert und befähigt vor allem Patienten mit guter Gesundheits- und technischer Kompetenz», so das Fazit. «Sie kommt Menschen entgegen, die ihre Gesundheit aktiv und eigenverantwortlich mitgestalten wollen und können.» Für die grosse Mehrheit der Weltbevölkerung, der es sowohl an der notwendigen Bildung als auch an medizinisch-sanitärer Grundversorgung fehlt, ist sie schlicht bedeutungslos.