Sozialhilfe: So wird den Armen der Rechtsweg versperrt
Sozialhilfeabhängige haben einen schweren Stand, wenn sie sich gegen fehlerhafte Entscheide zu wehren wagen. Das Justizsystem diskriminiert sie, obwohl sie Anrecht auf Rechtsschutz hätten. Eine engagierte Beratungsstelle versucht, das Schlimmste zu verhindern.
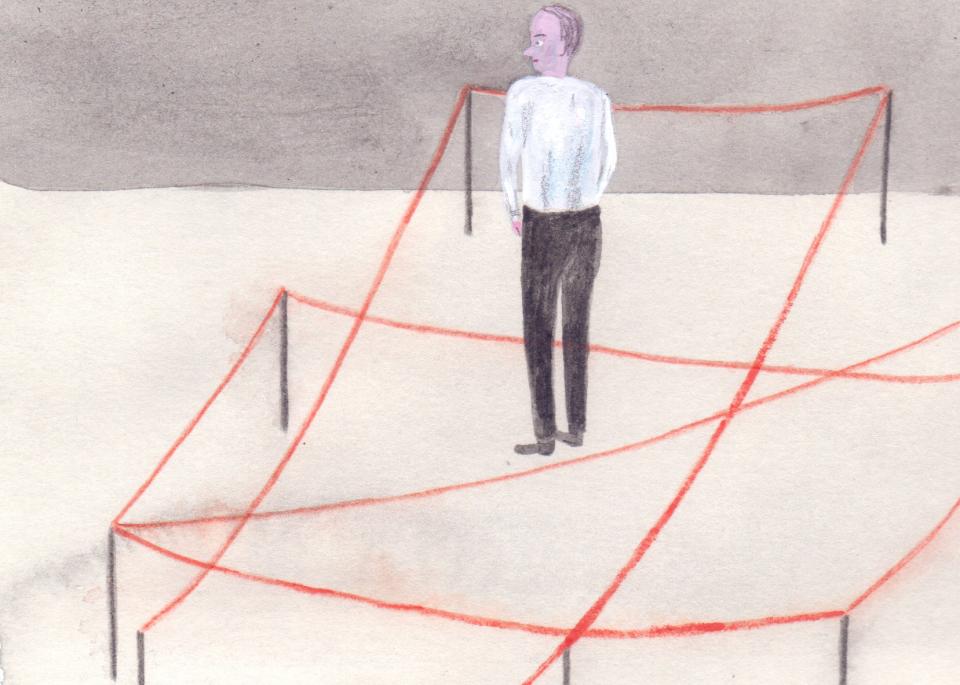
Das Sofa hat er selbst gemacht, aus Holzpaletten und Matratzen. Es trotzt der alten, sanierungsbedürftigen Wohnung etwas Gemütlichkeit ab. Hier wohnt ein Mensch, der schon lange mit wenig Geld auskommen muss. Linus Beck*, Ende dreissig, hat Kräutertee mit Zitrone gemacht und einen Stapel Couverts bereitgelegt. Ihr Inhalt dokumentiert seine Sozialhilfegeschichte.
Das jüngste Kapitel davon ist eine Mahnung: 700 Franken soll er zahlen, Verfahrenskosten plus Verzugsgebühren. Er hatte gegen die Sozialhilfeverfügung der Gemeinde Beschwerde eingereicht, Streitpunkt waren die Mietkosten. Jede Gemeinde legt in einer Richtlinie fest, wie viel die Wohnung eines Fürsorgeabhängigen maximal kosten darf. Becks Anteil von 600 Franken sei zu hoch für jemanden in einem Dreipersonenhaushalt, befand das Amt, ab dem nächstmöglichen Kündigungstermin würden nur noch 467 bezahlt. Die Differenz fehlt ihm jetzt beim Grundbedarf, und das trifft ihn auf seinem Finanzniveau empfindlich. Eine günstigere Bleibe müsste er erst einmal finden. Seine Beschwerde hatte keinen Erfolg, er bekommt weiterhin nur den tieferen Mietansatz – und muss als unterliegende Partei die Verfahrenskosten tragen. Diese schlucken fast ein ganzes Monatsbudget: Mit dem tieferen Mietansatz stehen ihm noch 754 Franken zur Verfügung.
Im Widerspruch zur Verfassung
Fälle wie dieser lassen den JuristInnen der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilfeberatung (UFS) in Zürich die Haare zu Berge stehen. Die UFS berät Menschen, die in die Behördenmühle geraten sind, und beschreitet wenn nötig den Rechtsweg (vgl. «Spezialisierte Beratung» im Anschluss an diesen Text). «Laut Bundesverfassung haben Mittellose Anrecht auf unentgeltliche Prozessführung», sagt Tobias Hobi, Rechtsanwalt bei der UFS. Will heissen: Auf Gesuch hin werden sie von den Verfahrenskosten befreit. «Darauf werden sie in den Rechtsmittelbelehrungen in den Sozialhilfeverfügungen aber meist nicht hingewiesen», weiss Hobi. Der Aargau, wo Linus Beck wohnt, geht hier noch einen Schritt weiter, indem er Betroffene geradezu irreführt. In Verfügungen steht dort standardmässig der Satz: «Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d. h. die unterliegende Partei hat (…) die Verfahrenskosten (…) zu bezahlen.» Die mögliche Kostenbefreiung wird unterschlagen. Wenn jemand trotzdem kämpferisch genug ist, Beschwerde einzureichen, erhält er ein Merkblatt der zuständigen Instanz, auf dem wieder steht: «Beschwerdeverfahren sind kostenpflichtig.» Erst fast am Schluss findet sich ein Hinweis in Juristenjargon: «Unentgeltliche Rechtspflege (…) kann nur auf schriftliches Gesuch hin gewährt werden.» Beck erschloss sich der Inhalt des Satzes nicht. «Woher hätte ich das wissen sollen?», sagt er. «Niemand hatte mich vorher darüber aufgeklärt.»
Für Tobias Hobi ist klar: «Mit dem Hinweis auf das Kostenrisiko werden die Leute von Beschwerden abgeschreckt.» Und dass man offensichtlich Mittellosen gestützt auf ein Merkblatt Verfahrenskosten auferlege, stehe in krassem Widerspruch zur Bestimmung in der Bundesverfassung. Trotzdem hat das Aargauer Verwaltungsgericht diese Praxis abgesegnet: In einem Urteil von 2016 entschied es, der eine Satz im Merkblatt mache (genügend) auf die unentgeltliche Rechtspflege aufmerksam; wer kein Erlassgesuch stellt, muss auch bei Bedürftigkeit zahlen. Bliebe noch das Verfahrenskostendekret, in dem es heisst: «Bedeutet (…) die Gerichts- und Entscheidgebühr (…) für die zahlungspflichtige Person eine untragbare Härte, kann sie angemessen reduziert werden.» Dazu schreibt Martin Diriwächter, Leiter der Aargauer Beschwerdestelle (SPG), die SPG wende konsequent einen «reduzierten Ansatz» an. Ein Kostenerlass im Sinne der Verfassung ist offenbar kein Thema.
Mit allen Mitteln schikaniert
Linus Beck ist langsam ins Abseits geschlittert. Rückenschmerzen und Migräneattacken plagten ihn schon lange. «Aber wenn man jünger ist, verkraftet man das besser», erzählt der Mann, der einen körperlich fordernden Beruf erlernt hat. «Ich boxte mich durch, solange es ging.» Am Schluss reichte die Kraft auch für Gelegenheitsjobs nicht mehr. Als Beck auf dem Sozialamt um Hilfe ersuchte, hatte er noch sechzig Franken Bargeld bei Kontostand null. Ein paar Verlustscheine hatten sich bereits angesammelt. Diese werden ausgestellt, wenn bei Schulden nichts mehr da ist, das gepfändet werden könnte.
Damit ist er keine Ausnahme. Sozialhilfe gibt es erst, wenn alle Stricke gerissen sind. Wenn der Lohn nicht zum Leben reicht oder jemand ausgesteuert ist, keine unterstützungspflichtige Person herangezogen werden kann, alle Wertgegenstände verkauft sind. Weil die Existenz der Betroffenen dann direkt von den Fürsorgeämtern abhängt, ist es ein hochsensibles Rechtsgebiet. Aber ausgerechnet hier sieht der Gesetzgeber keinerlei Schutzmassnahmen vor. Während im Arbeits- und Mietrecht, bei der Opferhilfe oder den Sozialversicherungen subventionierte Beratungsangebote geschaffen wurden, sind Menschen wie Beck auf sich allein gestellt.
Das dadurch bestehende Machtgefälle ebnet den Weg für Missbrauch. Tobias Hobi berichtet von Fällen, in denen SozialhilfebezügerInnen von Ämtern mit allen Mitteln schikaniert werden, zum Teil auch mit rechtswidrigen Methoden. (Zum Schutz der Betroffenen werden hier keine Einzelheiten genannt.) Aber auch ohne böse Absicht würden sehr viele Fehler in sozialhilferechtlichen Verfügungen produziert, sagt Hobi. «Das liegt daran, dass oft keine juristischen Fachleute an der Ausarbeitung der Entscheide beteiligt sind.» Laien in Gemeindegremien seien in der Schweiz grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, man denke etwa an eine Baukommission, «nur sind die Auswirkungen nirgends so einschneidend, wie wenn es um die materielle Existenzsicherung geht».
Auch im Fall von Linus Beck hat das Amt einen Fehler gemacht. Er hat aber keine Chance, das Prozedere zu durchschauen und den Verstoss zu finden. Seine Argumente in der Beschwerdeschrift sind zwar nachvollziehbar, aber juristisch nicht wirksam. Beck muss sich also damit abfinden, dass seine zu «hohe» Miete fünfzehn Prozent seines Monatsbudgets verzehrt. Er schränkt sich also noch etwas mehr ein, schlittert noch etwas weiter ins Abseits.
Andere trifft es noch härter. Der UFS liegen schauderhafte Akten von Sozialdiensten vor: Eine Behörde stoppte die Zahlungen für eine vierköpfige Familie, weil die Mutter eine Lohnabtretung nicht unterschreiben wollte – obwohl Lohnabtretungen in so einem Fall verboten sind. Die Frau musste zum Überleben Kredite aufnehmen. Ein anderes Amt bestrafte eine ganze Familie dafür, dass der Vater seine finanzielle Vergangenheit nicht offenlegen wollte oder konnte: Es verweigerte auch dann noch ordentliche Sozialhilfe, als die Mutter oder eines der Kinder mehrmals wöchentlich auf der Gemeinde erschien, um Kleinbeträge zu erbetteln.
Diese Menschen sind ohne juristischen Beistand verloren. Die Bundesverfassung hätte auch hier vorgesorgt: Sie spricht Mittellosen neben dem Recht auf unentgeltliche Prozessführung auch das Recht auf eine kostenlose Anwältin zu. In der Praxis wird das aber häufig vereitelt. Denn laut Bundesgericht muss jemand dafür «in schwerwiegender Weise betroffen» sein, oder der Fall muss «besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten» bieten. Das lässt Interpretationsspielraum, und der wird oft zuungunsten der Betroffenen genutzt. UFS-Juristin Zoë von Streng berichtet von einem älteren Mann, der wegen einer Gehbehinderung nicht an einem verordneten Arbeitseinsatz teilnehmen konnte. Obwohl gegen ihn deswegen die härteste finanzielle Sanktion verhängt wurde und vier sich zum Teil widersprechende Arztgutachten vorlagen, wurde dem Mann die kostenlose Rechtsvertretung verweigert. Begründung: Der Fall sei weder besonders schwerwiegend noch komplex, er könne auch ohne Anwalt Beschwerde führen.
Als Betroffener eine Anwältin für Sozialhilferecht zu finden, ist aber ohnehin sehr schwierig. Es gibt kaum spezialisierte Fachleute auf diesem Gebiet. Zudem trägt eine Juristin das Risiko, nicht bezahlt zu werden: Eine Beschwerde verfasst sie auf gut Glück, weil in der Regel erst mit dem Urteil der zuständigen Instanz darüber entschieden wird, ob dem Klienten ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zusteht. Zoë von Streng, die den gehbehinderten Mann vertreten hat, wäre als frei praktizierende Anwältin also zunächst leer ausgegangen. Mit der UFS im Rücken zog sie den Fall ans Verwaltungsgericht weiter – und erhielt recht: Der Betroffene habe Anspruch auf juristische Vertretung, urteilte die zweite Instanz.
Aber selbst wenn ein Rechtsbeistand zugestanden wird, sind Sozialhilfefälle für JuristInnen meist Verlustgeschäfte. Denn sie bekommen nicht den tatsächlichen Aufwand vergütet, sondern erhalten eine von der Beschwerdeinstanz festgelegte Pauschale. Und die wird mit Vorliebe unrealistisch tief angesetzt. Aktueller Negativrekord in einem von der UFS betreuten Fall sind 400 Franken. Für diesen Betrag arbeitet ein Durchschnittsanwalt keine zwei Stunden. Die Vorbereitung der Beschwerde hatte aber einen vollen Arbeitstag in Anspruch genommen. Die UFS ist denn auch aus diesem Problem heraus entstanden: als Rechtshilfeprojekt, damit Mittellosen langfristig Rechtsschutz ermöglicht wird, der aus Kostengründen sonst schlicht nicht geleistet werden kann.
Rechtswidrige Strafe
Linus Beck hat doch noch Glück. Sein Fall landet im Rahmen dieser Recherche bei der UFS. Mitgründer Andreas Hediger ackert sich durch die Akten und findet den Fehler der Gemeinde: Sie darf Beck nicht einfach den Mietbetrag kürzen, sondern muss ihn zuerst mit einer schriftlichen Auflage zur Suche nach einer günstigeren Wohnung auffordern. Solange sich Beck um eine neue Wohnung bemüht und keine verfügbare ablehnt, muss ihm die effektive Miete vergütet werden. Anders ausgedrückt: Man darf jemanden nicht dafür bestrafen, dass er zu teuer wohnt, solange er keine Möglichkeit hat, das zu ändern. «Das hätte eigentlich schon der Beschwerdestelle auffallen müssen, als sie bei der Behandlung von Becks Beschwerde die Unterlagen der Gemeinde prüfte», sagt Hediger. Er unterstützt Beck also dabei, eine neue, juristisch abgedichtete Beschwerde zu formulieren. Darin werden gleich noch die Nebenkosten eingefordert, die Beck ebenfalls nicht bezahlt wurden. Um diesmal 700 Franken zu sparen, reicht ein einziger Satz im Dokument: «Auf die Erhebung von Verfahrenskosten sei aufgrund meiner Sozialhilfeabhängigkeit zu verzichten.»
Die Beschwerde ist noch hängig. Eines steht aber schon fest: Die Gemeinde wird keine Verfahrenskosten tragen müssen, falls sie unterliegt. Das Aargauer Verwaltungsrechtspflegegesetz sieht vor, dass Behörden nur bezahlen müssen, «wenn sie schwerwiegende Verfahrensfehler begangen oder willkürlich entschieden haben». Sozialhilfeabhängige und andere Arme können hingegen weiterhin zur Kasse gebeten werden.
* Name geändert.
Spezialisierte Beratung
Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) ist die einzige spezialisierte Rechtsberatungsstelle für Sozialhilfeabhängige in der Schweiz. Sie ist als Stiftung organisiert und spendenfinanziert. Hundert Stellenprozente sind durch Freiwilligenarbeit gedeckt. Beratung und Rechtsbeistand sind für die Betroffenen kostenlos. Die UFS betreut gut tausend Fälle pro Jahr und muss ebenso viele aus Kapazitätsgründen ablehnen. Wenn niederschwellige Interventionen nicht ausreichen, ergreift sie ein Rechtsmittel. Seit ihrer Gründung 2013 hat sie 82 Prozent der Verfahren ganz oder teilweise gewonnen.


