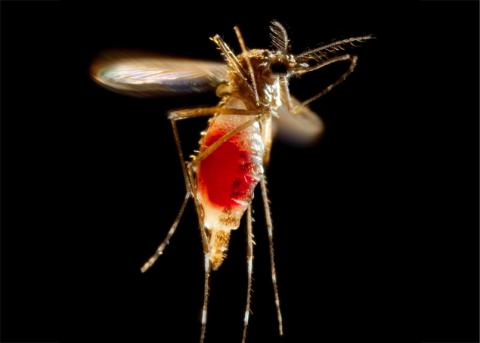HIV und Aids: Epidemie der Hindernisse
Lateinamerika wird im Gegensatz zu Afrika nicht gleich mit HIV assoziiert. Doch auch zwischen Feuerland und dem Rio Grande nimmt die Zahl der Infizierten stetig zu.
Andrea Rodríguez kennt den weissen Landrover mit dem roten Schriftzug «Medicos sin fronteras» gut. Das bullige Gefährt kommt vor einem kleinen Supermarkt in Villa El Salvador am Stadtrand von Perus Hauptstadt Lima zum Stehen. Die fünfjährige Andrea hüpft aufgeregt um den Wagen und will Elisabeth Flores und Patricia Salázar begrüssen. Die beiden Frauen der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sind dem Mädchen ans Herz gewachsen und werden von ihr ins Innere des gut bestückten Krämerladens geführt. Dort steht Doris Rodríguez - Andreas Mutter - am Verkaufstresen. Regelmässig kommen Flores und Salázar vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.
Erst vergangenes Jahr hat Doris Rodríguez, eine kleine, schmächtige Frau, den Laden eingerichtet. «Ich brauchte eine Aufgabe. Und von irgendetwas müssen wir ja leben», sagt sie und nimmt von Elisabeth Flores die Medikamentenpackung mit den Tagesdosen in Empfang. Fein säuberlich sind die Tage und Uhrzeiten markiert, an denen die bunten Pastillen eingenommen werden müssen. «Dein Cocktail», sagt Flores, eine Krankenschwester. Und Salázar, eine Psychologin, fügt hinzu: «Seit Doris die Medikamente nimmt, geht es ihr besser.» Sie habe zugenommen und wieder Zuversicht geschöpft.
Einmal pro Woche besuchen Flores und Salázar die Patientin und bringen Medikamente vorbei, denn Doris Rodríguez wäre über eine Stunde zum zuständigen Krankenhaus San José unterwegs. Auf dem staubigen Hof des Hospitals stehen weisse Container von Ärzte ohne Grenzen. Darin werden die Medikamente für einige Hundert AidspatientInnen und HIV-Positive gelagert, die in Villa El Salvador leben. In Kooperation mit dem peruanischen Gesundheitsministerium werden die PatientInnen von den freiwilligen ÄrztInnen und PflegerInnen der Hilfsorganisation versorgt.
Tabus und Stigmatisierung
Doris Rodríguez hat nur durch Zufall herausgefunden, dass sie HIV-positiv ist. Bei einer Routineuntersuchung ihrer Tochter Andrea entdeckte man die HI-Viren. «Es war naheliegend, dass ich die Viren an das Kind weitergegeben habe», sagt Doris. Den Schock hat die 37-Jährige bis heute nicht verarbeitet. «An Selbstmord habe ich gedacht und den Mann verflucht, der mich angesteckt hat», sagt sie. Sie sei die Geliebte eines verheirateten Mannes gewesen. Der habe sie und dadurch das gemeinsame Kind infiziert. Ihr Fall gilt als typisch in Peru. Meistens werden die Frauen beim ungeschützten Verkehr infiziert.
In Peru wird die Zahl der HIV-Positiven laut dem Uno-Programm UNAids auf zwischen 57 000 und 97 000 geschätzt, dies entspricht knapp 2,7 Promille der Bevölkerung. «Achtzig Prozent der Infizierten sind Männer, und 75 Prozent von ihnen leben im Grossraum Lima», sagt Flores. Der Anteil der HIV-infizierten Personen an der Gesamtbevölkerung liegt in Peru deutlich über dem vieler europäischer Staaten wie Deutschland, Britannien oder Frankreich - Ausnahmen sind die Schweiz mit einer Infektionsrate von knapp 3,3 Promille und Spanien mit rund 3 Promille.
«In Peru registrieren wir seit Jahren eine kontinuierliche Zunahme der Infektionen. Soziale Tabus fördern die Ausbreitung der Seuche», sagt Raúl Sánchez, Arzt im Spital San José. Der HIV-Spezialist mit einer roten Schleife am Revers kümmert sich sehr um seine PatientInnen; in Villa El Salvador ist es aber oft schwer, sie überhaupt erst ausfindig zu machen. In dem Viertel vor den Toren der peruanischen Hauptstadt leben zwischen Sanddünen und Schutthügeln rund 500 000 Menschen. Hier stranden viele Menschen aus dem Hochland der Anden auf der Suche nach besseren Perspektiven. Viele Träume enden im Staub von Villa El Salvador oder werden im Pisco - einem traditionellen Weinbrand - ertränkt. «Wir haben viele Fälle von familiärer Gewalt, Alkoholismus, Drogenkonsum und Missbrauch», erzählt Patricia Salázar.
Die Psychologin nennt noch weitere Gründe für die steigende Infektionsrate: «Kondome sind bei den peruanische Machos nicht sonderlich beliebt.» Ebenfalls problematisch ist für die SpezialistInnen der UNAids auch die Haltung der katholischen Kirche. Diese plädiere für feste Beziehungen und verschliesse die Augen vor der Realität, kritisieren Fachleute. Diese Kritik teilt auch der argentinische Arzt Guillermo Diller, der in Peru für das Gesundheitsministerium und die deutsche Entwicklungshilfe tätig ist. «Wenn wir uns nicht stärker auf Prävention und Aufklärung konzentrieren, dann drohen hier afrikanische Verhältnisse», sagt Diller und verweist auf die hohe Dunkelziffer in Lateinamerika sowie die vielen Tabus, die den ÄrztInnen die Arbeit erschweren.
Denn über Sexpraktiken, sexuelle Vorlieben oder Risiken wird kaum geredet. Häufig kennen weder Jugendliche noch Erwachsene die Übertragungswege einer HIV-Infektion. «Das ist mit ein Grund, weshalb die Auseinandersetzung mit HIV und Aids so schwierig ist», sagt Carmen Murguía vom peruanischen Aidsnetzwerk.
Für die peruanische Regierung hat HIV keine Priorität. So wird die Entscheidung für den Etat, mit dem antiretrovirale Medikamente eingekauft werden sollen, immer wieder verzögert. Doch auch in Kolumbien (Infektionsrate laut UNAids rund 4 Promille), Ecuador (knapp 2 Promille) oder Guatemala (4,6 Promille) fehlt es am politischen Willen, die Seuche effizient zu bekämpfen. Nahezu überall in Lateinamerika sind HIV-Positive noch immer stigmatisiert. Fälle, in denen Infizierte von ihren Familien verstossen werden, sind nicht nur in Peru, sondern auch in Nicaragua (Infektionsrate: 1,3 Promille) oder Uruguay (knapp 3 Promille) bekannt. In einer ganzen Reihe von Ländern ist die Behandlung der Krankheit zudem nur in den grossen Städten garantiert.
Aufklärung und Prävention
Dass es auch anders geht, zeigen das brasilianische und das kubanische Beispiel. «Dort wird öffentlich für den Gebrauch der Präservative geworben», sagt Carmen Murguía. In Brasilien ist sogar die katholische Kirche bei der Prävention mit von der Partie. Deren Aidsseelsorge begrüsst den Gebrauch von Kondomen - anders als die Kirchen in Peru, Kolumbien oder Guatemala. In Brasilien - wo die Infektionsrate bei knapp 3,9 Promille der Bevölkerung liegt - werden die antiretroviralen Medikamente gratis an die PatientInnen verteilt: Die Regierung lässt diese trotz des Widerstands multinationaler Pharmakonzerne und gegen deren Patentansprüche im eigenen Land herstellen. Auch die Aufklärung wird, nachdem die Betroffenen massiv Druck ausgeübt hatten, seit einigen Jahren vom Staat übernommen.
Obligatorische Tests
In Kuba wiederum rutschte das Thema HIV und Aids erst durch die internationale Berichterstattung über den Stand der Menschenrechte im Land auf die politische Agenda. Die ersten AidspatientInnen waren noch in Sanatorien regelrecht interniert worden. Erst seit Mitte der neunziger Jahre dürfen sie leben, wo sie wollen. Allerdings sind sie verpflichtet, sich behandeln zu lassen.
Inzwischen ist es in Kuba obligatorisch, dass bei jeder Blutuntersuchung automatisch auch auf HIV getestet wird. Dies und eine systematische Aufklärung an Schulen und in Betrieben haben dazu geführt, dass Kuba heute die niedrigste Infektionsrate des Kontinents aufweist - laut UNAids rund 0,5 Promille der Bevölkerung. «Das Rückgrat der kubanischen Präventionsarbeit bilden heute die rund 5000 Freiwilligen, die uns unterstützen», erläutert Rosaida Ochoa vom nationalen Präventionszentrum in Havanna. Ochoa ist Ärztin und selbst HIV-positiv. Seit Jahren wirbt sie auf nationaler wie internationaler Ebene für mehr Prävention.
Von den kubanischen und den brasilianischen Erfahrungen versuchen auch Raúl Sánchez und das Team von Ärzte ohne Grenzen im peruanischen Villa El Salvador zu profitieren. «Wir haben Patienten, die auf Informationsveranstaltungen über ihre Erfahrungen sprechen, sich organisieren und Druck von unten aufbauen.»
Für Doris Rodríguez mit ihrem kleinen Krämerladen wäre dieser Schritt noch zu früh. Aber auch sie verheimlicht nicht länger ihre Krankheit. «Viele meiner Nachbarn wissen es inzwischen. Und sie zeigen sich mir gegenüber solidarisch.» Das habe ihr die Kraft gegeben, ihren früheren Liebhaber zu verklagen und mit der Entschädigungssumme den Laden zu eröffnen.