Gemeinsames europäisches Asylsystem: Licht ins Wirrwarr der Paragrafen
Die EU-Institutionen haben sich nach jahrelangem Ringen auf eine Reform ihres Asylsystems geeinigt. Das Paket ist umfassend und unübersichtlich. Was darüber schon bekannt und was davon zu halten ist.

Wer an die europäischen Aussengrenzen denkt, stellt sich wohl Hightechinfrastruktur vor, moderne Grenzzäune, Überwachungstechnik, finanziert mit den Milliarden des reichsten Kontinents der Welt. Doch Filip Stipić sitzt in einem alten und heruntergekommenen Hotel: dem Asylzentrum Porin am Stadtrand von Zagreb.
Überraschend hat er die WOZ im vergangenen Juni eingeladen, mit ihm über das kroatische Asylsystem zu sprechen. Stipić ist Leiter der Abteilung für die Unterbringung und Aufnahme von Asylsuchenden. Er betont, dass in Kroatien alles mit rechten Dingen zugehe. Und beschwert sich über den Gesundheitszustand vieler Geflüchteter, die aus westeuropäischen Staaten nach Kroatien zurückgeschafft werden.
Weitreichende Verschärfungen
Am selben Tag treffen sich in Luxemburg die EU-Innenminister:innen, um die Zukunft des europäischen Asylsystems zu verhandeln: die Reform des Gemeinsamen europäischen Asylsystems (Geas). Sie einigen sich auf weitreichende Verschärfungen. Was er von den Plänen halte? «Ehrlich gesagt sehr wenig», sagt Filip Stipić im einladenden Konferenzraum des Hotels. «Die EU-Staaten glauben, dass Flüchtende, wenn man sie zu Tausenden in Zentren an der Grenze unterbringt, irgendwann einfach verschwinden.»
Stipićs Kritik, die er mit NGOs, Aktivist:innen und Fachpersonen in ganz Europa teilt, verhallt ungehört. Nach Jahren der Verhandlungen steht die Geas-Reform jetzt kurz vor der Verabschiedung. Viele Details der Reform sind noch unklar. In den Medien kursieren verschiedene Zahlen und teils widersprüchliche Aussagen über den Inhalt des Pakets. Die definitiven und konkreten Gesetzestexte existieren nämlich noch nicht.
Und was bedeutet das für die Schweiz?
Gerhard Pfister wills wissen: Im letzten Juni reichte der Mitte-Präsident erfolgreich ein Postulat ein, das den Bundesrat dazu auffordert, eine Einschätzung der Reform des Gemeinsamen europäischen Asylsystems (Geas) abzugeben. Die Antwort steht noch aus. Abgesehen davon blieb es in der Schweiz bislang recht ruhig rund um die Einigung der EU. Doch auch die Eidgenossenschaft ist am europäischen Grenzregime beteiligt. Wie genau betrifft sie die jetzige Reform?
Ein grosser Teil davon ist eine Weiterentwicklung des sogenannten Schengen-Besitzstands. Diese muss auch die Schweiz übernehmen, so wie zuletzt beim Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex. Das gelte aber nicht für alle Aspekte der EU-Reform, sagt der Sekretär von Solidarité sans frontières, Simon Noori.
Den Verhandlungsmandaten von Rat und Parlament lasse sich entnehmen, dass die Verfahrensverordnung auf die Schweiz nicht anwendbar sei, sagt er. Grenzverfahren muss die Schweiz also keine durchführen. Die Krisenverordnung werde für die Schweiz grösstenteils nicht gelten. Dagegen müsse sie die Screening- und die Eurodac-Verordnungen als Teil des Schengen-Besitzstands vollständig übernehmen. «Die Screeningverfahren werden aber vor allem die Flughäfen betreffen, wo ähnliche Verfahren bereits heute gängig sind», so Noori. Ebenfalls Teil des Schengen-Besitzstands ist die Managementverordnung – mit einer wichtigen Ausnahme: Am «Solidaritätsmechanismus» wird sich die Schweiz nicht beteiligen müssen. Sie wird also nicht einmal Ausgleichszahlungen an die Grenzstaaten leisten müssen.
In der Schweiz werden die Regelungen erst rechtskräftig, wenn sie vom Parlament oder – im Fall eines Referendums – von der Stimmbevölkerung abgesegnet werden. Der Prozess tritt in Kraft, wenn die Geas-Reform in der EU verabschiedet und die Schweiz darüber «notifiziert» wurde. Sie hat dann zwei Jahre lang Zeit, nachzuziehen.
Solidarité sans frontières fordert von der Schweiz, sich dezidiert gegen die Grenzverfahren und gegen eine Ausweitung der Drittstaatenregelung auszusprechen – und im Gegenzug freiwillig Geflüchtete aufzunehmen. Noori: «Geschieht das nicht, muss die Möglichkeit eines Referendums ernsthaft geprüft werden.»
Das liegt am komplizierten EU-Gesetzgebungsprozess: Ende Dezember einigte sich der Minister:innenrat unter Anleitung der Kommission mit dem EU-Parlament auf die Reform. Auf Basis dieser Einigung werden jetzt die Gesetzestexte verfasst, die baldmöglichst vom Parlament und vom Minister:innenrat verabschiedet werden. Das gilt als Formsache.
Um die Ergebnisse dieser Einigung schon jetzt möglichst verlässlich darlegen zu können, hat die WOZ mit fünf Expert:innen gesprochen. Ausserdem hat sie fraktionsinterne Zusammenfassungen der Grünen- und der Linksfraktion im EU-Parlament sowie NGO-Berichte, etwa des Border Violence Monitoring Network, miteinander abgeglichen.
Generalisiertes Scheitern
Fünf Verordnungen sind Teil des Pakets (vgl. Kurztexte im Anschluss an diesen Text). Sie alle regeln unterschiedliche Aspekte des Geas. Bei allen geht es um eine Intensivierung der Repression gegen Flüchtende an den Aussengrenzen der EU. Immer steht dabei der Umgang mit der «irregulären Migration» im Vordergrund – obwohl das Grenzregime der EU eine «reguläre» Fluchtmigration längst kaum mehr zulässt.
Kernelement der gesamten Reform sind die sogenannten Grenzverfahren, also Asylverfahren, die möglichst schnell und effizient direkt an den Aussengrenzen erfolgen sollen, ohne Rechtsvertretung und unter haftähnlichen Bedingungen. Dass die Grenzverfahren in erster Linie dazu da sind, möglichst schnell möglichst viele Leute abweisen zu können, bestreiten auch ihre Befürworter:innen nicht. Ein Kriterienkatalog in der Verfahrensverordnung regelt, wer ein Grenzverfahren durchlaufen muss.
Die Idee solcher Verfahren ist nicht neu. Das sagt auch der Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher Simon Noori; heute ist er politischer Sekretär von Solidarité sans frontières. «Es handelt sich um eine Generalisierung des Hotspotansatzes auf den griechischen Inseln», sagt Noori. Die Europäische Kommission erklärte 2015 fünf griechische Inseln zu Hotspots. Zunächst, damit sie besondere Unterstützung der EU erhielten. Bald darauf, im Anschluss an das EU-Türkei-Abkommen von 2016, durften Ankommende bis zur Klärung ihres Asylgesuchs ihre Auffanglager nicht mehr verlassen. Das Ziel war, möglichst viele von ihnen sofort in die Türkei zurückzuschaffen.
Es ist ein Prototyp für nun beschlossenen Grenzverfahren: «Solche geschlossenen Lager mit Schnellabfertigung soll es jetzt an allen Aussengrenzen geben», sagt Simon Noori. Das ist nicht nur bedrohlich – die katastrophalen Zustände auf den griechischen Inseln sind bekannt –, sondern auch verwunderlich: Der Ansatz ist gescheitert. Das behaupten nicht nur linke Kritiker:innen, sondern etwa auch der von der deutschen Bundesregierung finanzierte Sachverständigenrat Integration und Migration (SVR). 2021 kam dieser zum Schluss, die Hotspots seien systematisch dysfunktional.
Ohne Geld keine Deals
«Die Erfahrung mit den Hotspotzentren zeigt, dass sich ein solches System kaum lange aufrechterhalten lässt», sagt Bernd Kasparek. Der Kulturanthropologe forscht seit Jahren zum europäischen Migrations- und Grenzregime, derzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. «Bald waren die Inseln überfüllt, die kurzen Verfahrensfristen konnten nie eingehalten werden», so Kasparek. «Und die griechische Regierung kehrte langsam zur Praxis zurück, stillschweigend Flüchtende von Inseln aufs Festland weiterziehen zu lassen.»
Er bezeichnet die Vorstellung, überall an den EU-Aussengrenzen Grenzverfahren durchführen zu können, als «völlig realitätsfremd». Denn die geplanten Rückschaffungen in «sichere Drittstaaten» seien nicht so umsetzbar, wie es das neue Geas vorsehe. Auch dafür war der Hotspotansatz mit dem verbundenen EU-Türkei-Deal der Prototyp. Aber auch dieser Deal sei schliesslich gescheitert: «Sobald das Geld aufhört zu fliessen, sind solche Deals wieder aufgehoben», sagt Kasparek. «Es gibt kein Land, das sich dauerhaft dazu verpflichten wird, Europas Asylsuchende aufzunehmen.»
Die Gefängnisse und ihre Wärter
Das Grenzverfahren, wie es auf dem Papier konzipiert wurde, wird also wenig mit der Realität an der Grenze zu tun haben. Trotzdem wird die Infrastruktur dafür gebaut werden. «Es wird ein riesiger Gefängniskorridor rund um die EU entstehen», sagt Cornelia Ernst. Sie ist EU-Parlamentarierin für die Linkspartei und migrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, der Europäischen Linken. «Wir werden da Kinder haben, die in Gefängnissen rumturnen», so Ernst. Zunächst, so sieht es die Einigung vor, sollen die Zentren Platz für 30 000 Personen bieten, später soll diese Kapazität sukzessive auf 120 000 ausgebaut werden. Der Betrieb dieser Infrastruktur obliegt den Staaten an der EU-Aussengrenze.
Überhaupt wird auch weiterhin praktisch die gesamte Verantwortung für die Abweisung Flüchtender bei diesen Staaten liegen. Dabei war eines der zentralen Versprechen der Reform, als sie 2020 lanciert wurde, dass das europäische Asylsystem solidarischer wird. Derzeit sind Grenzstaaten für die Bearbeitung fast aller Asylgesuche zuständig. Das werden sie gemäss Geas-Reform auch weiterhin sein.
Wieso haben diese Staaten trotzdem zugestimmt? Entscheidend dürften zwei Faktoren gewesen sein. Erstens die generelle Verschärfung des Asylrechts, unter anderem mit der Implementierung der Grenzverfahren. «Das war das Geschenk, das man den Grenzstaaten gemacht hat», sagt Cornelia Ernst. «Man will ihnen ja jetzt in vielen Fällen erlauben, gar keine richtigen Asylverfahren mehr durchzuführen.» Zweitens wird viel Geld fliessen: Die Managementverordnung sieht mehr Zahlungen zuhanden der Grenzstaaten vor, die wiederum in die Befestigung der Grenzen fliessen werden. Die Festung EU ist längst zum kleinsten gemeinsamen Nenner ihrer Staaten geworden; im Stacheldraht kulminieren ihre «westlichen Werte».
Ein dritter wichtiger Aspekt sei die Krisenverordnung (vgl. «Wer verhängt den Ausnahmezustand?» im Anschluss an diesen Text), sagt Migrationsforscher Kasparek. «Diese wurde auf Druck der Grenzstaaten eingeführt.» Insbesondere für die Klausel der «Instrumentalisierung» hätten sich diese Staaten starkgemacht. «Ich kann mir gut vorstellen, dass sich manche Staaten, etwa Italien und Griechenland, immer wieder auf einen solchen Ausnahmezustand berufen werden», so Kasparek. Das würde bedeuten, dass die Grenzen immer wieder ganz dichtgemacht und praktisch alle Ankommenden ein Grenzverfahren durchlaufen werden – ohne im juristischen Sinn überhaupt EU-Boden betreten zu haben. Wobei auch hier gilt: Es handelt sich nur bedingt um eine neue Praxis, sondern eher um eine Legalisierung der bestehenden. Schon als 2021 Tausende Flüchtende die polnisch-belarusische Grenze zu überwinden versuchten, machte Polen seine Grenzen komplett dicht. In diese Richtung weist die jetzige Krisenverordnung.
Die ewige Norm
Die Reform des Gemeinsamen europäischen Asylsystems ist also die konsequente Weiterführung der bestehenden EU-Grenzpolitik. Trotzdem sind die Verschärfungen historisch. Insbesondere weil die EU viele der Praktiken, die an den Grenzen bislang nicht rechtmässig waren, aber geduldet wurden, jetzt mit dem ganzen Gewicht ihrer Institutionen anerkennt und stärkt. Die konkrete Ausgestaltung vieler Details mag noch unklar sein. Zweifellos aber ist die Reform des Geas ein Bekenntnis.
Und es ist ein grosser Sieg der Rechten, unter deren Druck die europäische Sozialdemokratie einknickte. Wann die Reform genau verabschiedet wird, ist noch nicht bekannt; es wird aber noch vor dem 6. Juni geschehen. Dann beginnt nämlich die nächste Wahl des EU-Parlaments. Zum Ende einer EU-Legislaturperiode werden Gesetzgebungsverfahren abgebrochen, die noch nicht abgeschlossen sind.
Auch deshalb habe sich in den Verhandlungen die besonders harte Position der Mitgliedstaaten gegen das Parlament durchsetzen können, glaubt Kasparek. Ein Grossteil der Sozialdemokratie habe wohl im Hinblick auf den Wahlkampf zugestimmt. «Man wollte diese Reform vom Tisch haben, damit man nicht mehr über dieses Thema sprechen muss», sagt Kasparek. Er glaubt aber, dass mit dem neuen Gemeinsamen europäischen Asylsystem auch dieses machtpolitische Kalkül kläglich scheitern wird. «In den kommenden Jahren wird sich zeigen, dass auch das neue System die Fluchtmigration nicht einfach zum Verschwinden bringen kann.»
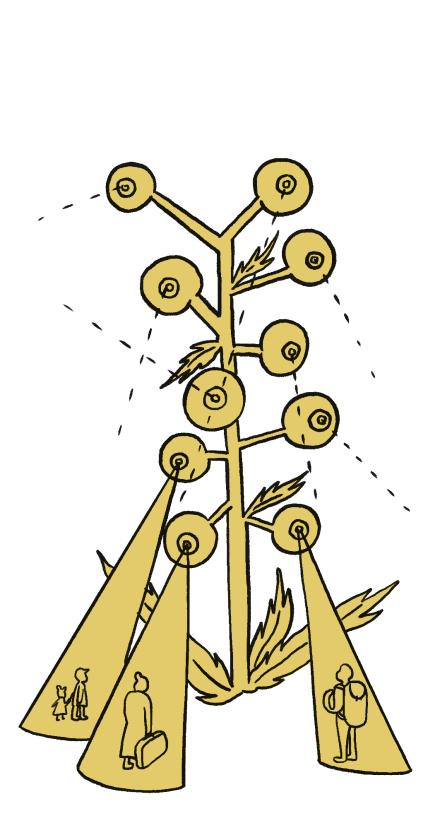
Screeningverordnung : Inhaftiert und durchleuchtet
Die Screeningverordnung betrifft den ersten Schritt jedes Asylverfahrens: den Erstkontakt zwischen den Behörden eines Mitgliedstaats und einer asylsuchenden Person. Das neue Gemeinsame europäische Asylsystem verlangt de facto ihre sofortige Inhaftierung in einem Zentrum, wo ein sogenanntes Screening durchgeführt werden soll. Dieser Prozess soll nicht länger als sieben Tage dauern.
Ziel des Screenings ist eine Kategorisierung der Einreisenden: Wie sind sie in den Staat gelangt? Was für Papiere von welchem Staat besitzen sie? Medizinische Fachpersonen sollen ausserdem ihren Gesundheitszustand überprüfen. Im Fokus wird aber vor allem die Sicherheitsprüfung stehen, für die den Behörden mehrere EU-Datenbanken, sowohl polizeiliche als auch migrationsspezifische, zur Verfügung stehen werden. Eine Überprüfung seitens der EU, ob sich die Mitgliedstaaten bei ihren Screeningverfahren an geltendes europäisches Gesetz halten, wird kaum erfolgen. Sie müssen keinen internationalen Organisationen oder NGOs Zugang gewähren.
Besonders umstritten war bis zuletzt Artikel 5 der Verordnung. Er besagt erstens, dass ein Screening auch dann noch veranlasst werden darf, wenn sich eine asylsuchende Person bereits seit längerer Zeit unregistriert auf einem Staatsgebiet aufhält. Das würde womöglich zu einer Intensivierung von Racial Profiling führen. Und zweitens, dass ein Screening an der Grenze auch unterlassen werden darf, sollte eine Person unmittelbar nach ihrer Festnahme in einen anderen Mitgliedstaat «zurückgeschickt» werden können. Kritiker:innen sprechen von einer «Formalisierung von Ketten-Pushbacks».
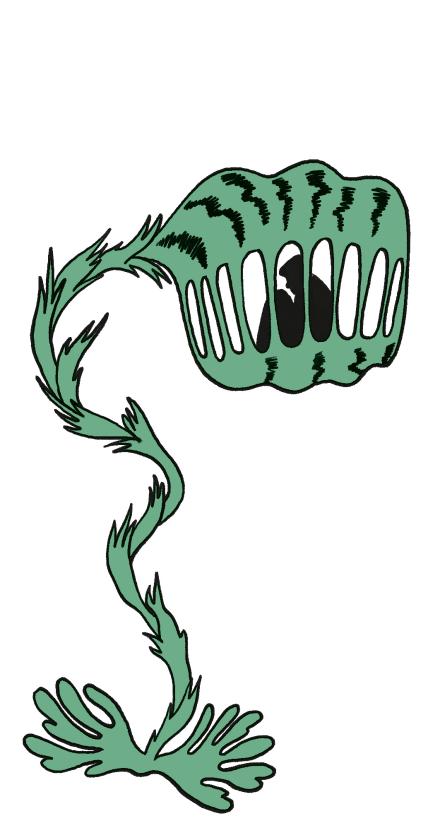
Verfahrensverordnung : Kurzer Prozess
Im Rahmen des Screeningverfahrens entscheidet sich, welche der Asylsuchenden ein sogenanntes Grenzverfahren anstelle eines regulären Verfahrens durchlaufen sollen. Auch Grenzverfahren werden in eigens dafür vorgesehenen Zentren unter haftähnlichen Bedingungen stattfinden. Es gilt die «Fiktion der Nichteinreise»: Auch wenn die Zentren auf EU-Territorium liegen, gelten die Internierten juristisch als noch nicht eingereist. «Ihre Rechtsgarantien sind deshalb niedriger», sagt der Migrationsforscher Bernd Kasparek.
Die Mitgliedstaaten müssen Grenzverfahren mit allen Asylsuchenden durchführen, die über einen «sicheren Drittstaat» eingereist sind oder die gemäss Screening ein «Sicherheitsrisiko» darstellen oder die die «Behörden irreführen», etwa indem sie keinen Pass auf sich tragen. Grenzverfahren sollen ausserdem auf alle Asylsuchenden angewandt werden, die aus Staaten stammen, deren Bürger:innen in der EU nur selten Schutz erhalten – also wenn nur zwanzig Prozent von ihnen auf dem ganzen Gebiet der EU nach einem Asylgesuch auch tatsächlich ein Bleiberecht erhalten.
Ausnahmen sind nur erlaubt im Fall von «einschlägigen» medizinischen Gründen. Ebenfalls ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige – aber nur, sofern sie nicht als Sicherheitsrisiko gelten. Grenzverfahren sollen höchstens zwölf Wochen dauern. Ihr Ziel ist, eine möglichst effiziente Abschiebung zu ermöglichen. Eine Rechtsvertretung steht den Internierten dabei nicht zur Verfügung; bloss eine «Beratung».
Der erste Schritt eines solchen Verfahrens ist die Prüfung, ob ein Asylantrag überhaupt zulässig ist. Wenn eine Gesuchstellerin über einen sicheren Drittstaat eingereist ist, zu dem sie eine «reasonable connection», also eine «vernünftige» Verbindung, hat, ist ihr Gesuch unzulässig – und sie kann dorthin abgeschoben werden. Der blosse Transit durch ein Land reicht dafür nicht aus, aber Fluchtmigration erfolgt meist nicht auf schnellstem Weg. Viele Flüchtende lassen sich in einem Transitland für eine Weile nieder, etwa um dort Geld zu verdienen. Abschiebungen nach Vorbild des britischen Ruandamodells bleiben illegal. Was als sicherer Drittstaat gilt, wird dereinst in einer EU-weit gültigen Liste festgehalten werden. Hinzu können nationale Listen kommen.

Managementverordnung : Zynische Solidarität
Das sogenannte Dublin-System regelte bislang, welcher EU-Staat für die Bearbeitung eines Asylgesuchs zuständig ist. Es ist immer derjenige, in den Flüchtende zuerst einreisen, üblicherweise ein Staat an den Aussengrenzen. Die jetzt beschlossene Asyl- und Migrationsmanagementverordnung wird die derzeit geltende Dublin-III-Verordnung ersetzen – aber deren zentrale Elemente beibehalten. Auch das künftige europäische Asylsystem sieht vor, dass jeweils der Staat der Ersteinreise für die Asylgesuche zuständig ist.
Eine Verschärfung ist geplant: Die derzeit gültige Dublin-III-Verordnung sieht vor, dass ein Staat, der nicht für die Bearbeitung eines Antrags zuständig ist, die verantwortlichen Behörden um eine Rückübernahme ersuchen muss. Künftig soll vor der Rückschaffung eine «Meldung» anstelle einer Anfrage genügen. Trotzdem beschwören die Verantwortlichen der Reform einen angeblichen «Solidaritätsmechanismus». Die Kommission soll demnach den Mitgliedstaaten regelmässig einen Verteilschlüssel für einen Teil der Geflüchteten vorschlagen.
Tatsächlich Personen aufzunehmen, bleibt aber völlig freiwillig. Denn das Gemeinsame europäische Asylsystem sieht zwei alternative Möglichkeiten der «Solidarität» vor: erstens finanzielle Beiträge, die auch für den Grenzschutz, für den Bau von Internierungsanlagen oder für Stacheldraht verwendet werden können – in Mitgliedstaaten oder auch in Drittstaaten. Zweitens Sachspenden, also etwa Container. Welche Beiträge als Ersatz für die Aufnahme von Menschen infrage kommen, darüber entscheiden Mitgliedstaaten und Kommission. Die entsprechende Liste soll für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Auch die Höhe der Beträge, die dereinst fliessen sollen, ist unklar, mehrere Zahlen kursieren. Am plausibelsten scheint der oft genannte Betrag von 20 000 Euro pro Person, die einem Staat zugeteilt worden wäre – und die dieser nicht bei sich aufnehmen will.
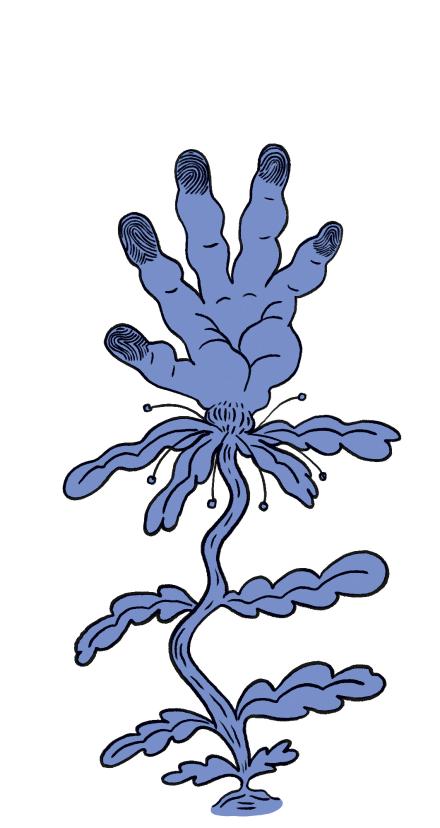
Eurodac-Verordnung : Alle Daten allen
Wer in die EU einreist und an der Grenze aufgegriffen wird, wird von den Behörden erfasst. Diese scannen die Fingerabdrücke und legen sie in einer Datenbank mit dem Namen Eurodac ab. So können Staaten feststellen, ob eine asylsuchende Person schon in einem anderen Dublin-Staat registriert wurde. Falls die Datenbank einen Treffer anzeigt, ist das gemäss Dublin-III-Verordnung die Grundlage für eine spätere Rückschaffung.
Bislang sei Eurodac eine primitive Datenbank, sagt der Sozialwissenschaftler Simon Noori, der sich in seiner Forschung intensiv mit digitalen Techniken des Grenzregimes auseinandergesetzt hat. «Fingerabdruck, Geschlecht, Ort und Zeit der Erfassung – viel mehr steht da heute nicht drin», so Noori.
Jetzt soll Eurodac zu einer umfassenden Asyldatenbank ausgebaut werden – mit weitreichenden Folgen. Bald sollen auch Gesichtsscans sowie Herkunft, Geburtsdatum und Pässe darin abgespeichert werden. Das betrifft alle Einreisenden ab sechs Jahren. Diese Daten sollen dann auch den Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Staaten zur Verfügung stehen.
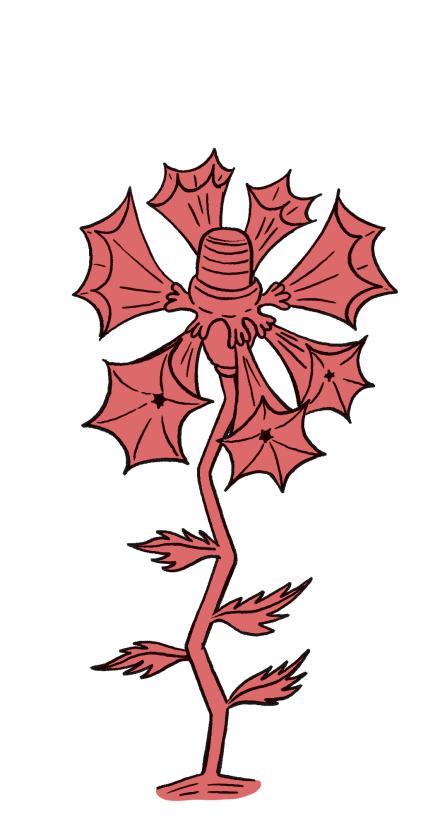
Krisenverordnung : Wer verhängt den Ausnahmezustand?
Die Folgen der Krisenverordnung sind aktuell besonders schwer abzusehen. Die Begriffe sind unscharf, das Potenzial für Willkür gross. Im Wesentlichen geht es bei dieser Verordnung darum, dass in bestimmten Situationen die Regeln des Gemeinsamen europäischen Asylsystems kurzfristig noch verschärft werden können. Um eine Krise ausrufen zu können, muss ein Mitgliedstaat einen entsprechenden Antrag stellen. Diesem müssen dann Kommission und Rat zustimmen.
Drei verschiedene Krisenszenarien sieht die Verordnung vor. Erstens die «höhere Gewalt». In der Einigung ist die Rede von ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen, die es einem Staat verunmöglichen, seinen asylrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das zweite Szenario betrifft sogenannte Massenankünfte, die das Asylsystem eines Staats überlasten. Das dritte Szenario war bis zuletzt umstritten und wurde auf Druck der Mitgliedstaaten eingeführt. Es betrifft Fälle der «Instrumentalisierung». Genauer: den Versuch eines Drittstaats oder «nichtstaatlichen Akteurs», einen Staat zu destabilisieren, indem er Geflüchtete an dessen Grenzen gelangen lässt – oder sogar selbst dahin bewegt. Die Linksfraktion des EU-Parlaments warnt, dass das potenziell auch die Seenotrettungseinsätze von NGOs umfassen könne.
Wie oft dereinst solche Krisen ausgerufen werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Dass der Ausnahmezustand zum neuen Normalzustand werden wird, ist nicht auszuschliessen. Während einer Krise soll der «Solidaritätsmechanismus» zwischen den Staaten weiter verstärkt werden. Die Aufnahme Geflüchteter bleibt aber fakultativ. Zudem können die Asylverfahren weiter verkürzt werden. Die Fristen zur Überstellung von Asylsuchenden gemäss Managementverordnung werden verlängert. Besonders gravierend ist die Ausweitung der Grenzverfahren: Im Fall einer Massenankunft sollen auch Personen aus Staaten mit einer europaweiten Schutzquote von bis zu fünfzig Prozent nur noch die speziellen Grenzverfahren durchlaufen dürfen. Wird eine Situation der «Instrumentalisierung» ausgerufen, gilt das sogar für alle Neuankommenden.

